Der Sonntag gehört diesmal nicht den Künsten und den für sie zuständigen Musen, aber der Klio.
Anfang des Jahres las ich Adam Zamoyskis Opus „1812. Napoleons Feldzug in Russland”, was ich seit dem Erscheinen des Buches (auf deutsch) anno 2012 schon lange tun wollte, und danach, von der Erstlektüre tief beeindruckt, gleich noch einmal wiederholte. Warum gerade jetzt? Möglicherweise, weil mein Ehegespons zur selben Zeit dieses Buch zu lesen begann.

Vielleicht auch, weil Ridley Scotts Napoleon-Monumentalschinken gerade in die Kinos kam, vielleicht, weil Winter war; es mag obendrein daran gelegen haben, dass Deutschland momentan auf einen Krieg mit Russland zusteuert.
Sei’s, wie es sei: Dieses Buch ist groß, weil sein Gegenstand groß ist und der Verfasser sich ihm gewachsen zeigt. Es überwältigt den Leser mit aller Entsetzlichkeit und Brutalität, die diesem ersten totalen Krieg der Geschichte innewohnten, aber auch mit dem Heroismus und der unglaublichen Leidensfähigkeit der Akteure. Allein die Tatsache, dass der französische Teil der multinationalen Grande Armée – und von jenem am Ende natürlich nur die Überlebenden – zu Fuß von Paris nach Moskau und wieder retour marschierte, also knapp sechstausend Kilometer, mit allem Gepäck, zurück teilweise bei Temperaturen von minus 30 Grad und tiefer, hungernd, frierend, krank, Verletzte und Kanonen mitschleppend, unter ständigen Gefechten, übersteigt jede Vorstellungskraft (die Wehrmacht verfügte 130 Jahre später immerhin über Kraftfahrzeuge, Eisenbahnen und Fluggerät). Man schätzt heute, dass zwischen Juni und Dezember 1812 auf russischem Gebiet etwa 550.000 bis 600.000 Mann der Franzosen und ihrer Alliierten operierten – Napoleons Armee erhielt während dieser Monate permanent Verstärkung –, von denen nur etwa 120.000 überlebten. Etwa 30.000 wurden als Leichtverwundete zurückgeschickt, eine mittlere fünfstellige Zahl desertierte während des Vormarschs, an die 100.000 Mann gerieten in russische Kriegsgefangenschaft, von ihnen kehrte 1814, nach Napoleons erster Abdankung, etwa ein Fünftel heim. Die militärischen Verluste auf russischer Seite lagen mindestens ebenso hoch, hinzu kommt eine unbekannte Zahl getöteter und verhungerter Zivilisten. Insgesamt, notiert der aus einer 1939 nach Amerika emigrierten polnischen Adelsfamilie stammende Historiker, starben „zwischen dem Übergang der Grande Armée über den Njemen Ende Juni 1812 und dem Ende des Feldzugs im Februar 1813 etwa eine Million Menschen, wobei sich die Opferzahlen ziemlich gleich auf beide Seiten verteilten”. Die meisten französischen Soldaten kamen nicht in unmittelbaren Kämpfen ums Leben, sondern erfroren, verhungerten oder wurden auf dem Rückzug massakriert.
Und da ich gerade las, dass PETA ein Verbot des Missbrauchs von Pferden als „Zugtiere“ fordert: Im Krieg der Menschen gingen auch unzählige Pferde zuschanden. Als sich auf dem Vormarsch der Grande Armée bei Wilna „ein Unwetter biblischen Ausmaßes” (Zamoyski) mit eiskaltem Regen über die Truppe ergoss, verendeten binnen 24 Stunden etwa 40.000 Tiere (auch zahlreiche Soldaten kamen in dem Wetter um), und als die russischen Behörden im Frühjahr 1813 das Schlachtfeld von Borodino säuberten, zählten sie 35.478 Rosskadaver. Abertausende Pferde erfroren und verhungerten auf dem Rückmarsch oder wurden, teils noch lebendig, von den vor Hunger halb wahnsinnigen Franzosen verzehrt.
So unmöglich es ist, einer Million Schicksale auf 620 Seiten (ohne Anmerkungen) gerecht zu werden, vereint Zamoyskis Meisterwerk doch eine Schicksalsdichte wie selten ein Buch zuvor. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Historiker die gesamte Erinnerungsliteratur der Zeit ausgewertet hat und, wo immer es sich anbietet, Augenzeugen das Wort überlässt. Nahezu sämtliche Quellen und Dokumente zu den politischen und militärischen Ereignissen, die sein Buch behandle, seien seit Jahrzehnten veröffentlicht und allgemein verfügbar, heißt es im Vorwort. Mir fällt spontan Daniel Furrers Dokumentation „Soldatenleben. Napoleons Russlandfeldzug 1812” ein, erschienen zum 200. Jahrestag desselben und eine Fülle von Augenzeugenberichten versammelnd. Doch Zamoyskis Gesamtschau erhebt sich darüber, es ist Geschichtsschreibung – Geschichtserzählung – in meisterlichem Stil. Ich bin nicht unbelesen in der Geschichte der napoleonischen Ära, und doch war ich wie erschlagen von diesem Buch; viele Passagen sind so aufwühlend, dass es einen kaum mehr auf dem Stuhl hält. Dem Weltgesetz folgend, dass dort, wo die hemmungsloseste Gewalttätigkeit und die größte Erbärmlichkeit walten, sich unweigerlich auch Mut, Güte und Opferbereitschaft erheben, bildet Zamoyski ein Panorama des nach unten und oben Menschenmöglichen ab, das seinesgleichen sucht.
So zählt die Verteidigung beider Ufer der Beresina gegen die anstürmenden Russen am 28. November, während die Reste der fliehenden Grande Armée auf zwei improvisierten Holzbrücken über den Fluss drängten, die Pontoniere in unglaublich kurzer Zeit unter Einsatz ihres Lebens im eiskalten Wasser errichtet hatten, fraglos zu den größten Heldentaten der Weltgeschichte. Zwar ist der Name des Dnepr-Nebenflusses in Weißrussland den meisten Menschen heute noch als Ort einer historischen Katastrophe mit tausenden ertrunkenen, erfrorenen, zertrampelten und von der russischen Artillerie zerfetzten Opfern bekannt, doch von den heroischen Verteidigern der Passage weiß kaum jemand.
Am östlichen Ufer verteidigte Marschall Claude-Victor Perrin, genannt Victor, mit seiner Nachhut, insgesamt um die achttausend Mann, die Brücken gegen die Armee von General Graf Peter von Wittgenstein, der über 30.000 Mann ins Feld führte. „Am Nachmittag leitete Wittgenstein einen zweiten Angriff auf Victors Defensivkräfte ein, und die Badener Brigade musste nun doch zurückweichen. Aber Victor warf jetzt die Brigade des Großherzogtums Berg, die sich aus Deutschen und Belgiern zusammensetzte, und anschließend seine restliche Reiterei in den Kampf. Diese, bestehend aus hessischen Chevaulegers und badischen Husaren sowie französischen Jägern, alles in allem nicht mehr als 350 Mann, griffen unter der beherzten Führung von Oberst von Laroche mit so großer Verve an, dass sie die Russen in die Flucht schlugen. Ein Gegenangriff der russischen Kavallerie vernichtete praktisch alle Deutschen, aber die französischen Defensivtruppen waren gerettet worden, und als die Dunkelheit hereinbrach, hielten Victors Männer immer noch dieselben Stellungen besetzt wie am Morgen.”
Vergleichbares geschah am westlichen Ufer. Eine russische Armee unter General Evfemii Czaplic und Admiral Pawel Tschitschagow hatte die Beresina weiter südlich überquert und versuchte nun, den Flussübergang der Franzosen von der anderen Seite zu verhindern. Marschall Oudinot, der sich ihnen entgegenstellte, wurde von einem Granatsplitter getroffen, „seine zweiundzwanzigste Wunde. Napoleon, der zugegen war, übertrug (Marschall) Ney das Kommando und schärfte ihm ein, die Russen aufzuhalten, koste es, was es wolle, um den Rückzug der restlichen Grande Armée, der Nachzügler und schließlich Victors Leuten, zu decken. Das war viel verlangt. Czaplic und Tschitschagow verfügten über 30.000 ausgeruhte Soldaten, die keine gravierenden militärischen Verluste erlitten hatten. Ihnen konnte Ney lediglich eine Rumpfarmee von 12–14.000 ausgemergelten und halbverfrorenen Männern entgegenstellen (…) Dreiviertel der Kämpfenden waren nicht einmal Franzosen. Fast die Hälfte waren Polen; ferner gab es vier schweizerische Regimenter, einige hundert Kroaten der 3. Illyrischen Infanterie, einige Italiener, eine Handvoll niederländische Grenadiere und Oberst de Castros 3. Portugiesisches Regiment. Dieser kunterbunte Haufen aber zeigte sich der Lage hervorragend gewachsen. (…)
Obgleich sie zahlenmäßig schwach waren, zeigten sie unglaublichen Mut. Das holländische 123. Regiment der Leichten Infanterie, das aus nur noch achtzig Mann und fünf Offizieren bestand, jubelte, als es sich in den Kampf warf. (…) Die Schlacht tobte den ganzen Tag, wobei die Schweizer, nachdem ihnen die Patronen ausgegangen waren, nicht weniger als sieben Angriffe mit dem Bajonett führten. (…) Die Kämpfe endeten erst um elf Uhr nachts, als die Russen, denen es nicht gelungen war, die Verteidiger auch nur ein Zollbreit von ihren Stellungen zurückzudrängen, endlich aufgaben. Es war ein großartiger Sieg für die Franzosen, aber auch ein bitterer. Als sie Feuer machten und ihre Verwundeten abtransportierten, um sie notdürftig zu verbinden, war ihnen bewusst, dass sie sie am nächsten Tag würden zurücklassen müssen. Die vier Schweizer Regimenter hatten tausend Mann verloren, alle umfassten nun nicht mehr als dreihundert. (…) Das holländische 123. Leichte Infanterieregiment bestand nicht mehr. Die holländischen Grenadiere waren auf 18 Offiziere und sieben Mann anderer Dienstgrade geschrumpft.”
Was für ein Wahnsinn, sich so zu opfern!, denkt der Jetztsasse natürlich sofort. Freilich, ergeben hätten sich die Franzosen – ich belasse es der Einfachheit halber bei dieser nicht ganz zutreffenden Sammelbezeichnung – besser nicht, denn das hätte für die meisten den Tod bedeutet. Insbesondere die Kosaken pflegten Gefangene zu verprügeln und sodann bis aufs Hemd auszuplündern, was bei den herrschenden Temperaturen deren Überlebenschancen gegen Null senkte. Denjenigen, die russischen Bauern in die Hände fielen, erging es oft noch schlimmer. Beim Einmarsch hatten die Franzosen und ihre Verbündeten den Landbewohnern alles weggenommen, was sich essen, an die Zugtiere verfüttern, zum Übernachten, für Lagerfeuer sowie zum Bau provisorischer Unterkünfte verwenden ließ, überdies oft genug noch die Frauen geschändet und die Dörfer im Zustand völliger Verwüstung zurückgelassen, nun nahmen die Bauern Rache, indem sie Zurückbleibende und Gefangene zu Tode prügelten, lebendigen Leibes verbrannten oder begruben, auf Pfähle spießten, mit siedendem Pech tauften und dergleichen schaurige Exzesse mehr.
Aber wohnt den damaligen Geschehnissen etwas inne, das übers gruslig-Anekdotische ins Überzeitliche hinausreicht? Wie regelmäßige Besucher des Kleinen Eckladens wissen, bin ich sehr wohl dieser Ansicht; für mich beginnt die Zeitgenossenschaft in der Antike, auch wenn mich zuweilen die Ahnung anweht, das Menschengeschlecht könne gerade dabei sein, sich von aller bisherigen Geschichte abzustoßen, um in einen beispiellosen nachhistorischen Zustand einzutreten; insbesondere dem Menschen des Westens gerät ja gerade der gesamte hinter ihm liegende kulturgeschichtliche Horizont aus den Augen und aus dem Sinn. Einstweilen aber ist der Blick in die Geschichte immer auch noch einer in den Spiegel, der unweigerlich die Frage nach Ähnlichkeiten und Unterschieden im Vergleich zur Gegenwart provoziert, und sei das Ergebnis nur ein wohlfeiles „Nie wieder ist jetzt”.
Eine Reihe von Aspekten bietet sich im Falle des Russlandfeldzuges 1812 dafür an. Zuerst die Frage nach der Mentalität oder, wenn man so will, geistigen Verfasstheit derer, die damals gen Osten zogen; diese Männer (und Frauen) sind ja nur durch fünf Generationen von uns getrennt. Sodann drängt sich ein Vergleich des Napoleonischen Russlandfeldzuges mit jenem von 1941 geradezu auf – es gibt verblüffende Parallelen. Schließlich manifestiert sich in der Gestalt Bonapartes die heute gern bestrittene Rolle des großen Mannes in der Geschichte. Überdies bin ich ein Freund der intellektuellen Spielerei des Was wäre gewesen, wenn? Historische Ereignisse haben ja die Eigenschaft, sich in der Rückschau zu Folgerichtigkeiten zu gruppieren, die mit Zwangsläufigkeit eintraten – und doch hätte alles ganz anders laufen können. Napoleon hätte diesen Krieg gewinnen können. Er stand mehrfach um Haaresbreite davor.
Also der Reihe nach (es wird wieder elend lang).
***
Die Grande Armée war eine multinationale oder multikulturelle Truppe, wie man sie seit der Schlacht auf den Katalaunischen Feldern nicht mehr gesehen hatte. Nicht einmal zur Hälfte bestand sie aus Franzosen. Die deutschen Rheinbundstaaten stellten das größte ausländische Kontingent (auch wenn die genauen Mannschaftsstärken uneindeutig sind, weil man gern höhere Zahlen „nach oben” meldete; sogar die legendäre Kaiserliche Garde umfasste nie mehr als 25.000 Mann, obwohl sie nominell mit der doppelten Stärke antrat), das zweitgrößte kam aus dem Herzogtum Warschau. Während die Polen in der Hoffnung auf eine Wiederherstellung ihres Königreichs in den Grenzen von 1772 stritten – eine Hoffnung, die Napoleon enttäuschte, was man zu seinen strategischen Fehlern zählen muss, denn er hätte einen nationalen Aufstand der Polen im Rücken der russischen Truppen auslösen können –, marschierten Deutsche, Italiener, Schweizer, Kroaten, Spanier, Portugiesen, Holländer, Iren und ein paar Nordafrikaner praktisch motivlos gen Moskau. Es sei denn, einige Kombattanten befanden sich darunter, denen die Verbreitung der französischen Freiheit am revolutionären Herzen lag. Wie man den zeitgenössischen Berichten entnehmen kann, kämpften die ausländischen Truppenteile nicht minder tapfer als die französischen. Die Franzosen folgten immerhin ihrem Kaiser, der ein französisch dominiertes Europa mit Paris als neuem Rom errichten wollte. Was aber trieb ihre Verbündeten – oder soll man besser sagen: Vasallen? – an?
Viele der Deutschen, schreibt Zamoyski, „waren von der Idee beseelt, die Russen aus Europa zurückzudrängen, und sie brannten darauf, die Vortrefflichkeit der deutschen Waffen unter Beweis zu stellen. Selbst wenn sie die Franzosen nicht liebten, neigten sie dazu, die Deutschen aus anderen Regionen noch weniger zu mögen, wobei die meisten Truppen des Rheinbunds eine deutliche Abneigung gegenüber den Preußen bekundeten” – bei denen sich bekanntlich der antinapoleonische Widerstand formierte. „Schließlich spielte auch militärische Ehre eine Rolle.“
Das klingt inzwischen wie Nachrichten von einem anderen Planeten. Aber es wird noch exotischer. Dem Gros der Kriegsteilnehmer, auch den Franzosen, waren die Ziele des Feldzuges nicht nur unklar, sondern oft schlechterdings egal. „Manche meinten, Napoleon habe einen Geheimpakt mit Alexander geschlossen, und dass eine französisch-russische Armee gegen die Türken ziehen solle, um sich deren Gebiete in Europa und Asien zu nehmen; andere behaupteten, dass der Krieg uns nach Indien führe, wo wir die Engländer vertreiben sollten“, entsann sich ein Freiwilliger. „Das alles kümmerte mich herzlich wenig: ob wir nun nach rechts, links oder geradeaus gingen, war mir gleichgültig, solange ich in die weite Welt kam“, schrieb ein anderer. „Meine Freunde und meine Kameraden aus Kindertagen dienten fast alle in der Armee; sie waren schon dabei, Ruhm anzuhäufen. Sollte ich meine Hände untätig in den Schoß legen und mich in Erwartung ihrer Rückkehr mit Schande bedecken? Ich war achtzehn Jahre alt.“ Und ein Füsilier im sechsten Garderegiment schrieb an seine Eltern, er breche auf nach den „Grandes Indes“ oder möglicherweise nach Ägypten: „Mir ist das ganz einerlei; ich wünschte, wir würden bis ans Ende der Welt gehen.“
So spicht das abenteuerliche Herz. Diese jungen Männer zogen mit einer schwer begreiflichen Unbekümmertheit und einem aus heutiger Sicht monströsen Desinteresse an ihrer Zukunft in den Krieg. Das grenzenlose Vertrauen in die Fähigkeiten des Kaisers und dessen Pläne mag dafür mitursächlich gewesen sein; man konnte zwar verwundet oder getötet werden, aber die Möglichkeit einer Niederlage existierte für sie nicht. Wer die Erinnerungsliteratur liest, gewinnt überdies den Eindruck, dass diese jungen Männer den Tod nicht nur keineswegs fürchteten, sondern verblüffend wenig am Leben hingen. „Ich freue mich darauf, getötet zu werden, denn ich krepiere schon durch das Marschieren“, schrieb ein Rekrut seinen Eltern in Frankreich. Zahlreiche seiner Altersgenossen schossen sich schon beim Hinweg eine Kugel in den Kopf. Wenn nach dem Durchqueren der endlosen Weiten Russlands endlich einmal Aussicht auf eine Schlacht bestand, verbreitete sich plötzlich gute Laune im Heer. „Kampftage galten als Feiertage”, notiert Zamoyski. „Die Männer hatten sich die ganze Nacht über vorbereitet, und der Aufgang einer herrlichen Sonne am 28. Juli zeigte uns im farbenprächtigen Glanz einer Parade. Waffen blitzten, Helmbüsche flatterten; erwartungsvolle Freude spiegelte sich auf jedem Gesicht; alle waren vergnügter Stimmung“, erinnerte sich ein Marineinfanterist namens Henri Ducor.
Und das wirkt alles noch zivil im Vergleich mit der Gegenseite. Zwar empfand manch junger russischer Offizier vor der Schlacht bei Borodino Ähnliches wie seine Altersgenossen auf der Gegenseite, etwa der Artillerie-Leutnant Nikolaj Mitarewskij: „Ich dachte an Bücher, die den Krieg behandelten – vor allem ‚Der Trojanische Krieg‘ ging mir nicht aus dem Sinn. Ich brannte darauf, an einer großen Schlacht teilzunehmen, alle Gefühle zu spüren, die diese Erfahrung mit sich bringt, und hinterher sagen zu können, an einer solchen Schlacht teilgenommen zu haben.“ Zwar hatte Napoleon mit seinem Einmarsch den Patriotismus der Russen geweckt wie kurz zuvor jenen der Deutschen; die Russen verteidigten ihr Land gegen Okkupanten, Plünderer und, wie sie meinten, Feinde des Christentums, ja, den Antichristen höchstselbst. Aber die russische Armee „glich keiner anderen in Europa”, wie Zamoyski festhält.
„Ein russischer Soldat wurde auf 25 Jahre verpflichtet, was praktisch einem Wehrdienst auf Lebenszeit gleichkam. Dass er die volle Zeit ableistete, war unwahrscheinlich, da nicht mehr als zehn Prozent die furchtbaren Bedingungen und das häufige Geprügeltwerden des Soldatenalltags überlebten.” Wenn ein Mann eingezogen wurde, kam seine Familie und häufig auch das ganze Dorf zusammen, um ihn zu verabschieden. „Das Ereignis wurde wie ein Begräbnis begangen.” Fahnenflucht war nahezu unmöglich, es sei denn, der Rekrut wollte fortan in den Wäldern leben, denn ein herrenloser Bauer wäre in Russland überall aufgefallen. „Die Männer wurden gnadenlos gedrillt und mussten so lange in Formation marschieren, bis sie gelernt hatten, als Masse zu operieren; man brachte ihnen bei, eher auf ihr Bajonett als auf ihre Muskete zu rechnen.” Zwischen den bäuerlichen Mannschaften und den adligen Offizieren existierte eine unüberwindliche Klassenschranke. Die Aufstiegsmöglichkeit durch Beförderung, wie sie bei den Franzosen unter Napoleon gang und gäbe war – ich nenne nur ein paar Marschälle als Exempel: Augerau war Sohn einer Obsthändlerin und eines Maurers, Lannes stammte aus einer Bauern‑, Murat aus einer Gastwirtsfamilie, der Vater von Saint-Cyr war Gerbermeister, der von Ney Böttcher, jener von Oudinot Brauer, der Lefebvres Polizeiwachtmeister –, bestand bei den Russen nicht; stattdessen setzte es Stockschläge für die geringfügigsten Vergehen. Auch in der Schlacht stand Gehorsam über allem. Wer Feigheit vor dem Feind zeigte, war sofort zu erschießen. Ein derartiger Drill vermochte „Solidarität, Durchhaltevermögen und die Fähigkeit erzeugen, fast alles zu ertragen”, resümiert der Historiker, förderte aber „weder Intelligenz noch Initiative”.
Wie eine solche Truppe kämpft, liegt, theoretisch, auf der Hand: Sie wird ihre Stellungen stur zu halten versuchen oder mit Gleichgültigkeit gegen den Feind anrennen, allerdings wenig Begeisterung und erst recht keinen Einfallsreichtum zeigen und sich wahrscheinlich schnell ergeben. Nicht wenige Beobachter glaubten damals, wenn Napoleon den Leibeigenen die Befreiung verspreche, würden sie in Scharen zu ihm überlaufen; die russische Seite befürchtete es. Praktisch geschah eher das Gegenteil. Im Angesicht des Feindes „zeigten die Männer allergrößten Patriotismus und Loyalität” (Zamoyski). Die russischen Soldaten kämpften mit einer Verbissenheit bis zum Tod, die die Franzosen entsetzte.
Am Rande: Die russische Armee verfügte 1812 trotzdem „wahrscheinlich über die professionellste Artillerie in ganz Europa“ (Zamoyski). Schon damals waren die Russen also die Könige der Artillerie, während sich Napoleon merkwürdigerweise nicht für die Qualität seiner Geschütze interessierte – für jene der Gewehre seiner Truppe übrigens ebenfalls nicht. Er dachte offenbar fast nur in Bewegungen; mit welchem Material seine Soldaten operierten, hielt er eher für nebensächlich.
Der Krieg in Russland unterschied sich von allen bisherigen Napoleonischen Kriegen, er war irrationaler, verbissener und sehr viel blutiger. Üblicherweise galt bei einem Treffen europäischer Armeen, dass man sich in aussichtlosen Situationen ergab, und man rechnete damit, dass der Gegner dasselbe tun würde. Aussichtslose Gemetzel widersprachen den Regeln, ja den Sitten; man wollte den Gegner als Streitmacht besiegen, aber nicht auslöschen. Dieses ungeschriebene Gesetz hatte sogar während des Guerillakrieges in Spanien weitgehend gegolten (die Kämpfe während der Eroberung Saragossas 1809 vielleicht ausgenommen). „Soldaten töten, ohne einander zu hassen“, zitiert Zamoyski Leutnant Blaze de Bury, der an Feldzügen in ganz Europa teilgenommen hatte. Während einer Feuerpause besuchte man oft das Lager des Gegners, „und obgleich wir bereit waren, uns beim ersten Signal wieder gegenseitig umzubringen, waren wir gleichwohl gewillt, einander zu helfen, wenn sich die Gelegenheit bot“. In Russland traf das alles nicht mehr zu. Napoleons Truppen mussten bei den Kämpfen in Krasny, Smolensk und Walutina Gora den Eindruck gewinnen: „Russische Soldaten streckten nicht die Waffen. Man musste sie in Stücke hauen.“ Ähnliches hatte schon Friedrich der Große im Siebenjährigen Krieg festgestellt, vor allem in der Schlacht bei Kunersdorf, als Russen und Österreicher die zahlenmäßig unterlegenen Preußen schlugen, aber die Russen auf seiten der Verbündeten den Blutzoll fast allein zahlten.
Die Franzosen waren jedenfalls verblüfft. „Ich hätte mir solche passive Tapferkeit, die ich seither hundertmal bei den Soldaten dieser Nation erlebte, nie vorstellen können, die, wie ich meine, von ihrer Unwissenheit und einem naiven Aberglauben herrührt“, schrieb Lubin Griois, Artillerieoberst im Korps Grouchy, der beobachtet hatte, wie ungerührt die russischen Soldaten stehen blieben, als er mit sich mit seiner Batterie bei Krasnyi auf sie einschoss. „Noch im Sterben küssen sie das Bildnis des Heiligen Nikolaus, das sie immer bei sich tragen; sie glauben, dass sie unmittelbar in den Himmel fahren, und bedanken sich fast noch für die Kugel.“
Im Gegensatz zur französischen Armee, die formell aus freien Bürgern bestand, waren die russischen Soldaten Unfreie, sie dachten weder an eine Rückkehr in ihr früheres Leben, noch lag die Möglichkeit einer Befreiung innerhalb ihres Vorstellungsvermögens. Die Kriegserfahrungen der Russen mit Türken und Kaukasusvölkern hatten überdies verhindert, dass in ihrem militärischen Bewusstsein die Option, sich zu ergeben, überhaupt existierte. Das mag die spezifisch russische Art der Kriegsführung erklären.
Auf ihrem Rückzug wendeten die Russen eine im restlichen Europa ebenfalls unbekannte Taktik an: die der verbrannten Erde. Sie evakuierten alle Städte und Dörfer, verbrannten die Vorräte, steckten Heuhaufen und Weizenfelder an und blockierten die Straße mit Hindernissen aller Art. „In der Nacht stand der ganze Horizont in Flammen“, beschrieb es ein französischer Artillerist. Auch das demoralisierte die Angreifer, die so etwas noch nicht erlebt hatten. Zugleich war nämlich das von Napoleon penibel geplante Nachschubsystem an der Wirklichkeit zerschellt. Die enormen Versorgungsprobleme der Grande Armée führten dazu, dass sie bereits auf dem Vormarsch wie eine Truppe wirkte, die sich auf dem Rückzug befand. Männer und Pferde hungerten, an den Rändern der Straße lagen Tote und Tierkadaver, und man hätte ein verlassenes russisches und ein verlassenes französisches Nachtlager allein an der Latrine identifizieren können (bei den Franzosen grassierte die Ruhr). „Das ganze Gebiet im Rücken der Grande Armée wimmelte von militärisch nutzlosen Soldaten, die das Land ausplünderten und die Bevölkerung in Wut versetzten. Banden von Deserteuren jeder Nationalität aus verschiedenen Truppenteilen, meist unter der Führung eines Franzosen, richteten sich in Herrenhäusern etwas abseits der Hauptstraße ein, auf der sie Durchreisende ausraubten.“ General Jean Rapp war über die Zustände im Hinterland entsetzt. „Seinem Bericht zufolge hinterließ die Grande Armée mehr Zerstörung als ein geschlagenes Heer, was bewirkte, dass die durchmarschierenden Rekruten, die sich der Hauptarmee anschließen sollten, von dem, was sie sahen, demoralisiert wurden. Viele verhungerten auf dem Weg; es verhungerten auch die frischen Pferde, die aus Frankreich und Deutschland herangetrieben wurden.“
Die Schlacht bei Borodino am 26. August – die einzige große Feldschlacht in diesem Krieg – war das größte Blutbad seit Menschengedenken. Die russischen Verluste lagen zwischen 38.000 und 58.000 Mann (nach neuesten Berechnungen 45.000), die Franzosen und ihre Verbündeten verloren etwa 30.000 Mann. Erst an der Somme 1916 sollten wieder so viele Männer an einem Tag fallen. Er habe „ein solches Gemetzel noch nie gesehen“, erklärte General Rapp. „Das verbissene Hauen und Stechen im Kampf um einige Erdwälle und das damit verbundene Gemetzel waren in der europäischen Kriegsführung etwas vollkommen Neues”, sekundiert Zamoyski. „Bisher war es üblich, dass zahlenmäßig unterlegene oder ausmanövrierte Einheiten eher zurückwichen.“ Es starben auch deshalb so viele Männer, weil beide Seiten sich in Reichweite der gegnerischen Artillerie aufgestellt hatten.
„Letztlich war es der Stoizismus der russischen Soldaten, der an diesem Tag (Marschall) Kutusows Ruf rettete. Sie kämpften und starben – oft sinnlos – dort, wohin man sie gestellt hatte“, urteilt der Historiker. Wäre den Russen indes das volle Ausmaß ihrer Verluste bekannt gewesen, hätte sich wohl Verzweiflung breitgemacht. Um zu verhindern, dass der Rest seiner Truppe sich auflöste, musste der russische Oberbefehlshaber Napoleon irgendwie abschütteln, „und das ging nur, wenn er ihm einen Köder vorwarf. So traf Kutusow die einzige brillante Entscheidung seines gesamten Feldzugs: Er beschloss, Moskau zu opfern, um seine Armee zu retten.“ Napoleon sei „wie eine Sturzflut, und wir sind noch zu schwach, sie aufzuhalten“, erklärte der russische Cunctator gegenüber seinem Generalquartiermeister Karl Wilhelm Graf von Toll. „Moskau ist der Schwamm, der ihn aufsaugen wird.“
Alle höheren Offiziere im russischen Hauptquartier waren über diese Entscheidung entrüstet, außer Marschall Barclay de Tolly, bis zu seiner Ablösung durch Kutusow Kommandeur der russischen Armee, der in lakonischem Realismus erklärte, eine Schlacht vor den Toren Moskaus würde dem Rest der Armee den Todesstoß versetzen, und er hoffe in diesem Falle, im Kampf getötet zu werden. Der Abmarsch der Armee habe einem Leichenzug geglichen, schrieb ein Zeitzeuge, „Offiziere und Soldaten heulten Tränen bitterer Wut“.
Das schafft mir die Überleitung zum Russlandfeldzug 1941.
***
Wie Napoleon griff Hitler Russland an, um eigentlich England zu treffen. Wie Napoleon rechnete er mit einem schnellen Sieg seiner militärisch überlegenen Truppen. Wie Napoleon begann er den Krieg im Sommer, ohne auch nur an den Winter zu denken und seine Armee mit Wintersachen auszurüsten. Wie Napoleon spielte Hitler va banque. Wie Napoleon verlor er in Russland alles. Wie 1941 vertrauten die Russen auch 1812 auf die Ausdehnung ihres Landes und verlängerten diese gewissermaßen noch durch die Taktik der verbrannten Erde. Wie 1812 waren die Russen 1941 schlechter organisiert, besaßen aber mehr und besseres Kriegsgerät als der Angreifer. 1941 waren große Teile der Roten Armee offensiv in den beiden Frontbögen von Bialystok und Lemberg disloziert und konnten von der Wehrmacht leicht eingeschlossen und besiegt werden, während die Grande Armée scheinbar auf einen defensiv eingestellten, ständig zurückweichenden Feind traf, was aber täuschte; es war nur der strategischen Einsicht Barclays, der Zerstrittenheit der russischen Führung und der Angst vor einem direkten Treffen mit Napoleon geschuldet, dass die Heere nicht aufeinanderprallten – was die russischen Truppen zu diesem Zeitpunkt wohl nicht überlebt hätten. Speziell der Hitzkopf Fürst Bagration tobte, er hätte, wäre er Oberbefehlshaber, Napoleon längst „pulverisiert“, und drohte mehrfach, allein loszuschlagen, doch Barclay rettete dem Zaren seine Armee. Zum Lohn ersetzte ihn Alexander I. kurz darauf durch den so aufgeblasenen wie zögerlichen Kutusow – Barclay war kein ethnischer Russe, sondern ein Deutsch-Balte, der mit den preußischen Offizieren im Heer Deutsch sprach, was viel Misstrauen auslöste, und geriet durch sein Zurückweichen in den Ruch, ein Verräter zu sein. Dieser Verdacht richtete sich übrigens gegen fast alle ausländischen Offiziere. Solche „Reibungsverluste” gab es unter Stalin nicht, dessen Fehlentscheidungen und sinnlose Angriffsbefehle in den Anfangsmonaten des Krieges bedeuteten aber auch so für Millionen seiner Soldaten den Tod. Alexander besaß die Klugheit, sich nicht an die Spitze seiner Truppen zu setzen – ihm hätte man einen Rückzug erst recht nicht verziehen.
Napoleons Armee war gewissermaßen die Wehrmacht des 19. Jahrhunderts, der russischen in offener Feldschlacht in jedem Fall überlegen. Wenn die Verluste sich in der Gesamtbilanz ungefähr die Waage hielten, lag das vor allem an den entsetzlichen Umständen des Rückzugs. Das taktische Verständnis der russischen Armee war limitiert, zum einen wegen der Unselbstständigkeit der einfachen Soldaten, zum anderen wegen der Unerfahrenheit und der erwähnten Zerstrittenheit des Offizierskorps. Die im Nachhinein geradezu genial erscheinende Strategie des notorischen Rückzugs mit allen negativen Folgen für die Grande Armée ergab sich ganz zufällig.
1941 half der Winter den Russen, den deutschen Vormarsch kurz vor Moskau zu stoppen, 1812 vernichtete der Winter die Franzosen auf dem Rückzug, nachdem sie zuvor Moskau mehr besetzt als erobert hatten – es gab ja keine Verteidiger. Beide Male hatten die Russen keineswegs vorgehabt, so weit zurückzuweichen, obwohl gerade die Überdehnung der Front im Kampf gegen die Wehrmacht und jene der Nachschubwege im Kampf gegen die Grande Armée ihnen im Zusammenwirken mit dem rauen Klima und der enormen Zähigkeit und Leidensfähigkeit der einfachen Soldaten den Sieg bescherten. Umgekehrt zeigten die Russen bei der Verteidigung ihres Landes 1812 eine ähnlich verbissene Opferbereitschaft wie in den Jahren 1941 bis 1945, obwohl die meisten von ihnen ein Leben führten, das diesen Einsatz unmöglich rechtfertigen konnte. Beide Feldzüge waren so blutig und grausam, wie man es im „gesitteten” Teil Europas nicht für möglich hielt. Borodino war in gewisser Weise das Stalingrad des 19. Jahrhunderts. Jede westliche Armee hätte in Stalingrad bereits zum Winteranfang kapituliert.
Eine weitere Analogie bestand darin, dass sowohl 1812 als auch 1941 viele Russen bzw. von ihnen beherrschte Völker die Angreifer kulturell bewunderten. Die russische Aristokratie am Anfang des 19. Jahrhunderts sprach französisch, die Moskauer Gesellschaft galt als frankophil – bis die Franzosen einmarschierten, dann entflammte die Treue zum Zar und die Liebe zu Russland. Auch in der Armee sprach man französisch. Das erste nächtliche Zwiegespräch zwischen Angehörigen beider Heere, nachdem eine Vorhut der Angreifer unbemerkt den Njemen überquert hatte, verlief etwa so: „Qui vive?” – „France!” – „Merde!”
Anno 1941 hassten die meisten Balten und Ukrainer Stalin und seine kommunistische Clique und sympathisierten mit den Angreifern, die sie noch für identisch mit den Kaiserreichsdeutschen hielten. Wenn die Nationalsozialisten keinen antikommunistischen Befreiungskrieg anzustacheln imstande waren, lag das einzig an ihrer Rassenideologie und der daraus folgenden Besatzungspolitik: Die Juden wollten sie allesamt ermorden, die Slawen als künftige Helotenvölker behandeln. Die Grande Armée ihrerseits verscherzte sich die Sympathien allein durch ihren enormen Verpflegungsbedarf und die daraus resultierenden Plünderungen.
Eine weitere Parallele zwischen den beiden Feldzügen bestand darin, dass nach dem mit hohen Verlusten errungenen russischen Sieg, der in beiden Fällen in der Hauptstadt des Angreifers besiegelt wurde, im Volk Hoffnungen auf mehr Freiheiten blühten; immerhin hatte man ja gemeinsam mit den adligen bzw. kommunistischen Offizieren gekämpft, gelitten und mit hohem Blutzoll dem Herrscher zum Triumph verholfen und erwartete nun eine Gegenleistung, wenigstens einen Dank. Stalin waren solche Befindlichkeiten vollkommen gleichgültig, und nach den Lockerungen der Kriegszeit schloss sich wieder sein eiserner Griff um seine Untertanen. Auch die Sieger von 1812 mussten begreifen, dass sie einfach so weiterleben sollten, als sei nichts geschehen; der Zar verbot freisinnige Gesellschaften und Klubs und ließ Säuberungen an den Universitäten durchführen. Im Dezember 1825, nach dem plötzlichen Tod Alexanders, ergriffen die Dekabristen die Gelegenheit zum Militärputsch. Nach dem Scheitern des Aufstandes wurden viele von ihnen zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt, wobei bemerkenswert ist, dass sich unter den Verurteilten 65 Offiziere befanden, die bei Borodino mitgekämpft hatten.
***
Clausewitz zufolge lag die russische Armee bei Borodino am späten Nachmittag „in den letzten Zügen“, und die Franzosen würden nur noch den Fangschuss setzen müssen. Aber er kam nicht. Stattdessen stellte Napoleon in dem Augenblick, als die russischen Verteidigungslinien durchbrochen waren, die Kampfhandlungen praktisch ein.
Im 28. Kapitel des Zehnten Teils von „Krieg und Frieden“ spottet Tolstoi: „Viele Historiker behaupten, die Franzosen hätten die Schlacht bei Borodino aus dem Grund nicht gewonnen, weil Napoleon den Schnupfen gehabt habe; hätte er den Schnupfen nicht gehabt, so wären seine Dispositionen vor und während der Schlacht genialer gewesen, Russland wäre untergegangen.“ Und fügt hinzu: „Jener Kammerdiener, der vergessen hatte, Napoleon am 24. August die wasserdichten Stiefel zu reichen, wäre folglich der Retter Russlands gewesen.“
Im Gegenteil, so der Dichter, habe Napoleon seine Rolle in der Schlacht bei Borodino „ebenso gut, ja noch besser” ausgefüllt als in anderen Schlachten. „Er tat nichts, was dem Gang der Schlacht hätte schaden können, schloss sich den Ansichten der Vernünftigsten an, brachte nichts in Verwirrung, widersprach sich selber nicht, er erschrak nicht und lief nicht vom Schlachtfeld davon, sondern führte mit dem ihm eigenen großen Feingefühl und mit all seiner Kriegserfahrung ruhig und würdig seine Rolle als scheinbarer Führer und Leiter durch.” Was so wenig den Tatsachen entspricht wie Tolstois Irrglaube, es sei ein russischer Sieg gewesen. Der Kaiser hatte nicht nur einen Schnupfen, er war krank und litt außerdem an einem Migräneanfall, was dazu führte, dass er an der Schlacht praktisch kaum teilnahm.
Dass ausgerechnet Tolstoi, ein Mann oberhalb jeden normalen Menschenmaßes, nicht nur als Dichter, auch als Philantrop, Hungersnotbekämpfer und Gesellschaftsreformer, den Einfluss des großen Mannes auf das historische Geschehen ins Lächerliche zu ziehen sucht – und das obendrein am Beispiel Napoleons –, mag einer Urteilserweichung namens Patriotismus geschuldet sein, hatte aber auch mit Tolstois christlichem Pazifismus zu tun. Krieg ist fürchterlich – trotzdem trafen und treffen sich überall Veteranen und schwelgen in Erinnerungen –, und Napoleon hat Hunderttausende Menschen wenn nicht auf dem Gewissen, so doch auf dem Kerbholz. Kaum jemand unter den Heutigen, der das Feld von Borodino am Abend der Schlacht sehen könnte, würde dessen Urheber nicht für einen Unmenschen oder zumindest für eine sittlich verurteilenswerte Existenz halten. Aber historische Größe ist mit moralischen Maßstäben allein nicht zu messen. Ginge es nach Tolstoi, hätte der Aufstieg – und Absturz – Napoleons wenig oder nichts mit dessen Persönlichkeit zu tun. Das ist absurd.
„Niemand, der die Zeit Napoleons nicht miterlebt hat, vermag sich den mitreißenden Einfluss vorzustellen, den er auf die Gemüter seiner Zeitgenossen ausübte“, schrieb ein russischer Offizier und fügte hinzu, dass sich bei jedem Soldaten, gleich auf welcher Seite, schon die bloße Erwähnung seines Namens mit der unmittelbaren Vorstellung grenzenloser Macht verband. Als des Kaisers Leibwächter, der Mameluck Roustam, im Dezember 1812 dem Wirt eines Gasthofs bei Kowno (Litauen), in dem man übernachtet hatte, das abgelegte Hemd und die Strümpfe Napoleons zum Wegwerfen gab, „rissen die Einheimischen die Sachen an sich, zerschnitten sie und verteilten sie untereinander, um sie als heilige Reliquien aufzubewahren” (Zamoyski). Es heißt, keiner der gefangenen Franzosen habe sich zu einer negativen Bemerkung über Napoleon verleiten lassen. Der kleine Korse war der Kriegsgott selbst. Selbst wenn er, wie Tolstoi unkte, tatsächlich keine Rolle im Sinne persönlichen Handelns gespielt haben würde, hätte er allein durch seine Anwesenheit gewaltig auf Freund und Feind gewirkt.
Gerade in Russland zeigte sich, dass nicht nur Napoleons Entschlüsse, sondern vor allem seine Missgriffe den Ausgang des Krieges entschieden haben. Wenn sich ein Kutusow später als Bezwinger des Kaisers spreizen konnte, war das nur ein Treppenwitz der Weltgeschichte. Zu diesem Sieg hatte der genusssüchtige und schon ein bisschen senile Feldmarschall militärisch wenig beigetragen, im Gegenteil, noch während des französischen Rückzugs gingen die russischen Generäle einer Konfrontation mit von Bonaparte persönlich geführten Truppenteilen in fast abergläubischer Furcht aus dem Wege. Dass die Russen den Krieg gewannen, war nicht ihr Verdienst, sondern den Fehlentscheidungen Napoleons geschuldet. Die Grande Armée litt zwar auf dem Rückzug unter den Angriffen der russischen Soldaten und Kosaken, doch die Franzosen entschieden bis zuletzt fast alle direkten Gefechte für sich; besiegt wurden sie letztlich vom russischen Winter und den Weiten des Landes.
Mitten in der Lektüre von „1812“ griff ich zu Kafkas Tagebüchern, was in seiner Anlasslosigkeit seltsam genug war, obendrein schlug ich ausgerechnet den (mir bis dato unbekannten) Eintrag vom 1. Oktober 1915 auf: „Fehler, die Napoleon beging“ – es geht um den Russlandfeldzug. Kafka bezieht sich auf die Memoiren des Generals Marcellin de Marbot und notiert durchnummerierte achtzehn Fehler, teils strategischer, teils taktischer Natur. Punkt 1 ist gleich der elementarste: „Entschluß zu diesem Krieg. Was wollte er erreichen? Strenge Durchführung der Kontinentalsperre in Rußland. Das war unmöglich. Alexander I konnte nicht nachgeben, ohne sich zu gefährden. Sein Vater Paul I war ja wegen des Bündnisses mit Frankreich und wegen des Krieges mit England, der Rußlands Handel unermeßlich geschädigt hatte ermordet worden. Trotzdem hoffte Napoleon noch immer, Alex. werde nachgeben. Nur um das zu erzwingen, wollte er am Njemen aufmarschieren.“
Das Besondere an Zamoyskis Buch ist, dass er nicht nur den Feldzug als solchen, sondern den Konflikt zwischen Napoleon I. und Alexander I. gewissermaßen ab ovo behandelt und mit der Zeit des großen Einvernehmens der beiden Monarchen beginnt, als sie in Tilsit die europäische Zukunft planten und sogar eine mögliche Neuaufteilung Asiens besprachen. Es ist ein Lehrstück darüber, wie Kriege beginnen können, obwohl sie keiner der Beteiligten recht eigentlich will, und wie sich auch ein Napoleon verschätzen und verheben konnte. Der Fehler zwei auf Kafkas Liste lautet, der Kaiser der Franzosen hätte wissen können, was ihn erwartet, habe aber sämtliche Warnungen in den Wind geschlagen. Womöglich wollte er den Russen wirklich nur mit seinem Riesenaufmarsch drohen und sie an den Verhandlungstisch zwingen.
Fehler Nummer acht: Napoleon übertrug seinem jüngsten Bruder Jérôme Bonaparte das Kommando über drei Armeekorps von insgesamt 60.000 Mann. Gleich beim Einrücken hatten die Franzosen die russische Armee in zwei Teile gespalten, Marschall Davout hatte Minsk besetzt und der 2. Armee unter Bagration den Rückzug abgeschnitten. Hätte Jérôme mit Davout zusammengearbeitet – das fand er aber mit seiner Würde als König von Westfalen nicht vereinbar –, wäre Bagration vernichtet oder zur Kapitulation gezwungen worden. Das langsame Vorrücken seines Korps war einer der Gründe, weshalb eine Umfassung der russischen 2. Armee misslang. Napoleon war verärgert und machte Jérôme Vorwürfe, dass er ihm einen Sieg verdorben hatte. Aber es war seine Fehlentscheidung gewesen, den Bruder, der noch nie an einem Krieg teilgenommen hatte, an die Spitze dreier Armeekorps zu stellen. (Jérôme marschierte mit seiner königlichen Garde am 16. Juli murrend und am Ende wahrscheinlich sehr glücklich zurück nach Kassel.) Erwähnt sei noch Fehler elf: die militärisch sinnlose Einschließung und blutige Eroberung von Smolensk, das voller Zivilisten war, nach Clausewitz Bonapartes größter Fauxpas, denn er hätte stattdessen Barclays 1. Armee am anderen Dneprufer angreifen, die Stadt links liegen und sie sich später ohne Widerstand in den Schoß fallen lassen können.
Jedenfalls – hätte, hätte, Dönerkette – besaß Napoleon mehrfach die Gelegenheit, die Zerstrittenheit der russischen Führung auszunutzen und die beiden gegnerischen Armeen zu vernichten; er ließ sie ungenutzt und ging in Moskau in eine Falle, von der man fairerweise sagen muss, dass sie jenseits des Vorstellbaren lag. Die Franzosen erreichten die Hauptstadt am 14. September. Dass Napoleon den Rückzug aber erst am 19. Oktober antrat – mit jeder Woche früher hätte er seine Chancen, das verbliebene Fünftel oder Sechstel seiner Armee aus Russland herauszuführen und Kaiser zu bleiben, dramatisch erhöht –, entschied letztlich sein Schicksal.
Der Russland-Feldzug warf sämtliche Regeln und Gewissheiten der bisherigen Kriegsführung über den Haufen. Nach dem schalen Sieg bei Borodino und der folgenden Einnahme Moskaus glaubte Napoleon – und mit ihm fast seine gesamte Generalität –, dass der Krieg gewonnen sei. Die Hauptstadt des Feindes besetzt zu haben, führte normalerweise zu dessen Kapitulation und Friedensverhandlungen. Der Empereur war verblüfft, dass ihn keine Übergabedelegation empfing. Dann war er bestürzt darüber, dass die (meisten) Russen die Stadt verlassen hatten und beim Rückzug offenbar gezielt Brände gelegt und Vorräte vernichtet worden waren. Aber es dauerte einen ganzen Monat, bis er seine tatsächliche Situation begriff.
So lange Napoleon dabei war, schlug der Rückzug nicht in eine panische Flucht um. Seine Anwesenheit hielt die Truppe zusammen. Es gibt einen berühmten Bericht des russischen Partisans Denis Dawydow, ein Husarenoffizier der Zweiten Armee, der mit Kutusows Billigung eine Guerilla anführte, von Puschkin als Held gefeiert und von Tolstoi als Denisow verewigt: „Die Alte Garde, bei der sich Napoleon befand, näherte sich. Wir sprangen auf unsere Pferde und erschienen wieder an der großen Straße. Als der Feind unseren lauten Haufen erblickte, legte er die Hand an den Gewehrhahn und setzte seinen Weg stolz fort, ohne seine Schritte zu beschleunigen. Allen unseren Versuchen, auch nur einen Mann aus diesen geschlossenen Kolonnen herauszureißen, setzten sie eisernen Widerstand, an dem all unsere Angriffe scheiterten, entgegen; nie werde ich den freien Schritt und die achtunggebietende Haltung dieser Soldaten vergessen, die dem Tod in allen seinen Gestalten ins Auge gesehen hatten. Mit ihren hohen Bärenfellmützen, ihren blauen Uniformen, dem weißen Lederzeug, mit den roten Federbüschen und Epauletten glichen sie Mohnblüten auf einem schneebedeckten Felde … Alle unsere asiatischen Angriffe vermochten nichts gegen diese geschlossene europäische Formation. … An diesem Tag nahmen wir noch einen General, allerlei Gepäck und 700 Soldaten gefangen, doch Napoleon und die Garde gingen durch unsere Kosaken hindurch wie ein mit 100 Kanonen bestücktes Linienschiff zwischen Fischerbooten.”
Selbstredend war der verhältnismäßig geordnete Rückzug vor allem auch das Werk der Marschälle und Generäle. Zwei Beispiele, die einfach nur atemberaubend in ihrer Kühnheit in eigentlich aussichtsloser Lage sind: Am 4. November trennte der russische General Graf Michail Andrejewitsch Miloradowitsch das Korps von Marschall Davout, das die Nachhut bildete, von den vorausgehenden Staffeln ab und nahm es von zwei Seiten in die Zange, während Partisanen gleichzeitig dessen Flanken attackierten. Die Nachhut befand sich in tödlicher Gefahr. Was taten die Vorausmarschierenden? Versuchten sie, sich weiter in Sicherheit zu bringen? „Fürst Eugène (de Beauharnais, Napoleons Stiefsohn, im Gegensatz zu Jérôme Bonaparte ein fähiger, in der Truppe geschätzter General) und (General) Poniatowski hörten die Kanonenschüsse und machten prompt kehrt. Sie konnten 13.000 beziehungsweise 3.500 Mann einsetzen und griffen so entschlossen an, dass Miloradowitsch zurückgeworfen und die Straße wieder frei war, während Ney, der ebenfalls kehrtgemacht hatte, die Zugänge nach Wjasma sicherte.”
Elf Tage später fand sich nunmehr Eugène mit seinen noch knapp 4000 Mann abgeschnitten und vom Feind umzingelt; russische Infanterie, mit Kanonen verstärkt, versperrte ihm den Weg nach vorn, während reguläre Kavallerie und Kosakenreiter seine Flanken umfasst hatten. Miloradowitsch entsandte einen Offizier mit weißer Fahne und ließ mitteilen, dass er über 20.000 Mann verfüge und Kutusow mit der Hauptarmee in der Nähe bereitstehe. „Fürst Eugène ließ die Geschütze abprotzen, die ihm noch verblieben waren, stellte sein Korps als geschlossene Kolonne auf und schritt zum Angriff.”
Man kann es drehen, wie man will: Das waren Helden.
Als sich Napoleon vor dem Einzug der Rest seiner Armee in Wilna von der Truppe absetzte und nach Paris fuhr, brach die Ordnung zusammen. Marschall Murat, der die Führung übernehmen sollte, fluchte lediglich, er werde sich in „diesem Pisspott” nicht einschließen lassen, und ergriff keinerlei Verteidigungsmaßnahmen. „In diesem Chaos hätte es der Anziehungskraft eines Kolosses bedurft, und dieser war soeben verschwunden“, schrieb der französische Diplomat Louis-Philippe de Ségur. „In dem dadurch entstandenen leeren Raum wurde Murat kaum bemerkt. Es ward nun sichtbar, wie unersetzlich ein großer Mann ist.“
Das führt mich zu Tolstoi zurück. In „Krieg und Frieden” (14. Teil, 18. Kapitel) schreibt er:
„‘C’est grand!‘, sagen die Historiker, und schon gibt es kein Gut und Böse mehr, sondern nur ein ‚grand‘ oder ‚nicht grand‘. ‚Grand‘ ist gut, ‚nicht grand‘ ist böse. ‚Grand‘ ist ihrer Ansicht nach eine Eigenschaft ganz besonderer Wesen, die sie Helden nennen. Und als sich Napoleon in seinen warmen Pelz hüllte, nach Hause fuhr und die Umkommenden im Stich ließ, die nicht nur seine Kameraden, sondern Leute waren, die er, wie er glaubte, selber dorthin geführt hatte, da fühlte er: ‚que c’est grand‘, und sein Gewissen war beruhigt.
Vom Erhabenen – er fühlte etwas Erhabenes in sich – zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt, sagte er, und die ganze Welt wiederholt fünfzig Jahre lang dasselbe: Erhaben! Groß! Napoleon der Große! Vom Erhabenen zum Lächerlichen ist es nur ein Schritt.
Und keinem kommt es in den Sinn, dass das Zugeben einer Größe, an die der Maßstab von Gut und Böse nicht mehr angelegt werden kann, nur ein Eingestehen der eigenen Bedeutungslosigkeit und maßlosen Nichtigkeit ist.
Für uns, die wir von Christus den Maßstab für Gut und Böse erhalten haben, gibt es nichts, was damit nicht zu messen wäre. Und wo keine Schlichtheit, Güte und Wahrhaftigkeit ist, da ist auch keine Größe.“
Der Dichter zitiert hier zweimal die Worte, mit denen Napoleon seinen Rückzug gegenüber seinem Sekretär und Großstallmeister Caulaincourt kommentierte: „Du sublime au ridicule il n’y a qu’un pas.” Selbstredend gehört ein solcher Absatz nicht in einen Roman, sondern in einen Besinnungsaufsatz, aber Tolstoi ist zu groß für solche Formalien; er kann schreiben was er will. Gleichwohl handelt es sich um ein Ressentiment. Nach Borodino, behauptet Tolstoi am Schluss von Teil zehn, sei die innere Kraft der französischen Truppen erschöpft gewesen. „Das eindringende französische Heer fühlte wie ein wütendes Tier, das bei seinem Ansatz zum Sprung eine tödliche Wunde empfangen hat, seinen Untergang herannahen, aber es konnte nicht innehalten.“ Nach diesem Rippenstoß habe sich das französische Heer noch bis Moskau hinschleppen können, dort aber „musste es an der bei Borodino empfangenen tödlichen Wunde verbluten“. Wir haben gesehen, dass das nicht zutrifft. Also kann auch Tolstois Folgerung daraus nicht stimmen. Jene nämlich:
„Die unmittelbaren Folgen der Schlacht bei Borodino waren die grundlose Flucht Napoleons aus Moskau, sein Rückzug auf der alten Smolensker Straße, die Vernichtung des eingedrungenen Heeres von fünfmalhunderttausend Mann, und der Untergang des Napoleonischen Frankreich, auf das bei Borodino zum erstenmal die Faust eines an Geist überlegenen Gegners herabgesunken war.“
Mit diesem überlegenen Geist kann er nur den christlich-orthodoxen meinen. Aus Respekt vor diesem bedeutenden Autor enthalte ich mich eines jeglichen Kommentars.
***
Der Rest ist der Rückzug, und das heißt: Szenen, mit denen verglichen Dantes Inferno wie die Schilderung eines aus dem Ruder gelaufenen Kindergeburtstages erscheint. Im brennenden Moskau degenerierte die Grande Armée endgültig zur Räuberbande, wenngleich ihr harter Kern erstaunlich kampfkräftig blieb; die Soldaten soffen, plünderten und vergewaltigten (bzw. nutzten die Versorgungsnot vieler Moskauerinnen aus), und als sie einen Monat später die Stadt verließen, glichen sie eher beutebeladenen antiken Städteeroberern als einer europäischen Armee der Neuzeit. „Das war nicht mehr die Armee Napoleons, sondern die des persischen Darius, die von einem großen Raubzug heimkehrte, mehr lukrativ als glorreich“, befand Graf Adrien de Mailly von den Carabiniers à Cheval.
In der Stadt brach Unruhe aus; Zivilisten, die mit den Franzosen zusammengearbeitet hatten oder auch nur in Moskau geblieben waren, befürchteten, nach dem Abzug vom Mob gelyncht zu werden, und schlossen sich ihnen in Scharen an. Wie auf dem Hinweg zogen auch auf dem Rückmarsch Abertausende Nichtkombattanten mit der Truppe und teilten ihr schreckliches Schicksal. Die Soldaten schleppten ihre Beute mit sich, manche warfen ihre Waffen weg und Artilleristen die Munition, um mehr transportieren zu können. Fuhrwerke aller Art, von der Kutsche bis zum Karren, waren mit Raubgut beladen. Napoleon hatte Marschall Mortier befohlen, die Stadt zu räumen, alle Verwundeten mitzunehmen und den Kreml in die Luft zu sprengen; dieser Krieg hatte auch im französischen Kaiser den rachsüchtigen Barbaren geweckt. „Zum Glück”, notiert Zamoyski, „hatten viele Zünder versagt, und obwohl erheblicher Schaden entstand, wurde der Kreml nicht zerstört.“
Keiner der auf kaiserlichen Geheiß abtransportierten Verwundeten kam je wieder nach Hause – die Blessierten andernorts, die den Kosaken oder den Einheimischen in die Hände fielen, wurden allesamt ausgeplündert, ohne Essen und Trinken ihrem Schicksal überlassen, aus den Fenstern geworfen oder auf andere Weise massakriert. Als in der einsetzenden Winterskälte unter den Marschierenden der Kampf ums Überleben begann, waren die Verwundeten die ersten, die man zurückließ. Nach Frostnächten unter minus 30 Grad standen am Morgen ganze Einheiten nicht mehr auf. Von Partisanen und Kosaken unbarmherzig attackiert, schleppten sich die Soldaten westwärts, ständig auf der Suche nach Brennmaterial für ein Lagerfeuer und irgendetwas Essbarem. Kein Tier auf dem Weg blieb verschont, zuletzt aßen die Rückzügler auch Menschenfleisch. „Ein totes Pferd”, schreibt Zamoyski, „wurde binnen Minuten steinhart, so dass sich sein Fleisch nicht mehr zerteilen ließ. Daher war es überlebenswichtig, ein noch lebendes Tier zu finden, aus dem sich Fleisch herausschneiden ließ. Angesichts dessen war es nur ein kleiner Schritt dazu, einem Pferd Fleisch aus dem Hinterteil zu schneiden, wenn sein Besitzer nicht hinsah. Wegen der Kälte fühlten die Tiere keinen Schmerz, und ihr Blut gefror sofort. Sie konnten mit ihren klaffenden Wunden im Gesäß noch tagelang weitergehen.”
Den Menschen erging es nicht anders. Napoleons Adjutant Planat de la Faye berichtet über einen italienischen Offizierskollegen, der allen Kameraden mit seiner Standhaftigkeit Mut gemacht hatte. „Nie habe ich einen Mann gesehen, der tapferer und fröhlicher war als dieser Piemontese“, schrieb er. „Schon vor dem Übergang über die Beresina waren ihm die Zehen an beiden Füßen weggefroren. In Smorgonj hatte sich Wundbrand entwickelt, und er bekam seine Schuhe nicht mehr an. Jede Nacht, wenn wir Rast machten, schnitt er die brandigen Stellen mit einem Messer ab und verband den Rest sorgfältig mit Lumpen, alles mit einer Fröhlichkeit, die einem das Herz zerriss. Am nächsten Tag setzte er, mit Hilfe eines Stocks, seinen Marsch fort, um sich dann am Abend wieder derselben Prozedur zu unterziehen, so dass er zu dem Zeitpunkt, als wir Wilna erreichten, nicht viel mehr als seine beiden Hacken übrig hatte.“ Dort wurde er über Nacht wahnsinnig.
„Man sah außergewöhnlich viele Soldaten, deren Hände und Füße nur noch aus Knochen bestanden, weil das Fleisch abgefallen war”, erinnerte sich Louis Joseph Vionnet de Maringoné, ein Offizier bei den Gardegrenadieren, der mir durch seine Anteilnahme am Schicksal der Moskauer Zivilbevölkerung im Gedächtnis geblieben ist.
Der Elendszug, der schließlich in Wilna eintraf, hatte nichts Menschliches mehr an sich – frische Truppen, die der zurückflutenden Grande Armée entgegengesandt worden waren, hatten bereits mit Entsetzen auf den Zustand ihrer Kameraden reagiert –: „Man kann die Einwohner, die sie in ihre Häuser ließen, nur bewundern. Die Männer waren halb wahnsinnig vor Hunger, übersät mit Geschwüren und klaffenden Wunden, verdreckt und verlaust. ‚Nichts verströmt einen bestialischeren Gestank als erfrorenes Fleisch‘, bemerkte Sergeant Thirion, und die Mehrzahl der Männer war mindestens an einigen Stellen von Erfrierungen befallen. Die Ruhr, unter der die meisten litten, hatte Spuren auf ihrer Kleidung hinterlassen, während ihr Mundgeruch, nach wochenlangem Verzehr von Pferdefleisch und verfaulten Abfällen, offenbar besonders ekelhaft gewesen sein muss.“
Neben den Soldaten starben Tausende Zivilisten. Die folgende Szene ereignete sich am Ostufer der Beresina. „Oberst von Kurz beobachtete voller Entsetzen, wie eine schöne junge Frau mit ihrer vierjährigen Tochter vergeblich die Brücke zu erreichen suchte. ‚Gleich darauf stürzte ihr Pferd, von einer Kugel getroffen. Eine andere zerschmetterte ihr den Schenkel über dem Knie. Mit der anscheinenden Ruhe stiller Verzweiflung nahm sie ihr weinendes Kind, küsste es öfters, löste das blutige Strumpfband vom zerschmetterten Bein und erdrosselte ihr Kind. Hierauf schloss sie das gemordete Kind in die Arme, drückte es fest an sich, legte sich neben ihr gefallenes Pferd und erwartete so den Tod. Nach wenigen Minuten war sie von den Hufen der andrängenden Pferde zertreten.“
Ich will es bei diesen schaurigen Anekdoten vom Rückzug bewenden lassen; das Buch liefert eine Fülle davon, eine fürchterlicher als die andere, aber auch zahlreiche Beispiele von selbstloser Hilfe und übermenschlichen Anstrengungen, um andere zu retten. Lassen Sie mich mit zwei Geschichten schließen, die den Schrecken mit einer gewissen Versöhnung verbinden.
Ein französischer Leutnant der 1. Polnischen Lanzenreiter konnte hinter Wilna nicht mehr weitergehen und setzte sich an den Straßenrand, um zu sterben. Ein Sergeant seiner Einheit versuchte, ihn zum Aufstehen zu bewegen, aber vergeblich. In diesem Moment sahen sie einen Schlitten die Straße herankommen. Der Sergeant frohlockte, aber als der Mann zu ihnen aufschloss, erkannte der Leutnant den Fahrer: Es war ein Soldat seiner Kompanie, den er wegen Plünderns hatte auspeitschen lassen. Der Schlitten hielt an, und der Fahrer stieg ab. „Er sagte dem Sergeant, er solle aufsteigen, dann ging er zum Leutnant hinüber. Nach einem Moment brach er in Gelächter aus, verpasste ihm einen kräftigen Boxhieb, hob ihn auf, drückte ihn auf den Schlitten und deckte ihn mit einer Felldecke zu. ‚Sie haben mich wegen ein bisschen harmloser Plünderei bestraft’, sagte er, als sie losfuhren, ‚aber Sie müssen zugeben, manchmal ist sie durchaus nützlich, und in diesem Augenblick macht es Ihnen nicht viel aus, dass ich diesen Schlitten mit dem guten Gespann geklaut habe, der uns aus diesem verfluchten Land hübsch herausbringen wird.’ ”
Der Generalintendant Mathieu Dumas hatte Gumbinnen in Ostpeußen erreicht, wo er Unterschlupf im Haus eines ortsansässigen Arztes fand. „Als er sich am nächsten Morgen gerade zu einem stärkenden Frühstück und einem guten Kaffee gesetzt hatte, ging die Tür auf, und ein Mann in einem braunen Mantel trat ein. Sein Bart war vom Rauch geschwärzt, und seine roten Augen leuchteten. ‚Hier bin ich endlich”, verkündete der Fremde. ‚Was ist, General Dumas, erkennen Sie mich nicht?’ Dumas schüttelte den Kopf und fragte ihn, wer er sei. ‚Ich bin die Nachhut der Grande Armée’, antwortete der Mann. ‚Ich bin Marschall Ney.’ ”
***
Zamoyskis Opus hat nur einen Makel: das Titelbild.
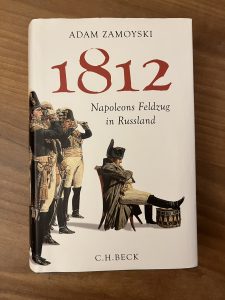
Das fällt aber in der Regel nur Menschen auf, die bei einer Illustrierten oder in der Graphikabteilung eines Verlags arbeiten oder gearbeitet haben. Etwas stimmt nicht. Achten Sie auf die Säbel bzw. Degen.
PS: Dass es sehr andere Zeiten waren anno 1812, erhellt auch aus der Beschreibung, womit sich ein französischer Offizier in Moskau für den Rückmarsch eindeckte: „Antoine Augustin Pion des Loches, den man eben erst zum Oberst der Garde-Fußartillerie befördert hatte, rüstete sich gegen alle Eventualitäten. In seinem kleinen Transportwagen verstaute er hundert große Stücke Trockenzwieback, einen Sack Mehl, dreihundert Flaschen Wein, zwanzig bis dreißig Flaschen Rum und andere Spirituosen, zehn Pfund Tee, zehn Pfund Kaffee, eine Menge Kerzen und, ‚falls wir unser Winterquartier östlich des Njemen aufschlagen würden, was ich für unausweichlich hielt, eine Kiste mit einer schönen Ausgabe der Werke Voltaires und Rousseaus, einer Geschichte Russlands von Le Clerc und einer von Levesque, den Stücken Molières, den Werken von Piron, Montesquieus l’Esprit des lois und einigen anderen Werken, darunter Raynals Historie philosophique, alles mit Goldschnitt und in weißem Kalbsleder gebunden.’ ”
PPS: Eine letzte Anekdote. Die Wendung „Im Kreml brennt noch Licht” ist seit Stalin eine geflügelte; der Woschd wacht rund um die Uhr über das Schicksal des Landes, heißt das. Der Kommunist Erich Weinert schrieb ein Gedicht des Titels „Im Kreml ist noch Licht”.
Ich schau’ aus meinem Fenster in der Nacht;
zum nahen Kreml wend ich mein Gesicht.
Die Stadt hat alle Augen zugemacht.
Und nur im Kreml drüben ist noch Licht.
Und wieder schau’ ich weit nach Mitternacht
zum Kreml hin. Es schläft die ganze Welt.
Und Licht um Licht wird drüben ausgemacht.
Ein einz’ges Fenster nur ist noch erhellt.
Spät leg’ ich meine Feder aus der Hand,
als schon die Dämmrung aus den Wolken bricht.
Ich schau’ zum Kreml. Ruhig schläft das Land.
Sein Herz blieb wach. Im Kreml ist noch Licht.
Es war aber Napoleon, auf den die Legende zurückgeht. Der Kaiser residierte im Kreml, in einer weiten Halle mit drei Salons und Blick auf die Moskwa. „Seinen Kammerdiener wies er an, jede Nacht zwei brennende Kerzen ins Fenster zu stellen, damit die vorbeiziehenden Soldaten sehen konnten, dass er wachte und für sie arbeitete.“