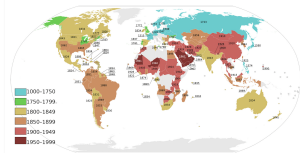Bei den meisten Aposteln der Mäßigung und des Verzichts handelt es sich um Menschen, von denen man sonst nie etwas zu hören bekäme; es sind Pharisäer, die uns mitteilen: Wenn mein Leben schon langweilig, glanz- und geistlos ist, dann soll es wenigstens möglichst lange dauern.
***
Die bedeutendsten Komponisten waren weiß und männlich. Die bedeutendsten Maler waren weiß und männlich. Die bedeutendsten Bildhauer waren weiß und männlich. Die bedeutendsten Autoren, egal welchen Genres, waren weiß und männlich. Da die Entwicklung der Künste als weitgehend abgeschlossen gelten darf, wird sich das niemals ändern lassen. Ich schlage deswegen vor, sie alle zu canceln.
***
Das Erstaunen darüber, wie viele Engel oder Seelen auf einer Nadelspitze Platz finden, ist jenem darüber gewichen, wie viele Propagandisten auf eine Ericusspitze passen.
***
Gestern wurden die letzten deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet. Man wird dieses Datum in Erinnerung behalten als den Tag, an dem die Stromrationierung ihren Anfang nahm.
Da ich zu diesem Thema genug gesagt habe, überlasse ich Leser *** den Tagesschau-Kommentar:
„Die sozialistische Einheitsfront aus Grünfaschisten, roten und gelben Sozialisten, unterstützt von den anderen demokratischen Kräften und den Nachrichtenschaffenden, macht im Auftrag des Wählers da weiter, wo die Abrißbirne aus der Uckermark aufgehört hat. Sie haben nie einen Hehl daraus gemacht, was sie vorhaben, und kreieren nun wie angekündigt einen feindlichen Akt nach dem anderen gegen das eigene Volk. Sie haben nur das angekündigt und gemacht, was sie am besten können: plündern und zerstören. Und das tun sie auch jetzt, denn dafür sind sie von der Mehrheit der Deutschen gewählt worden. Sie hatten es zu keinem Zeitpunkt nötig, ein Blatt vor den Mund zu nehmen oder die Bevölkerung zu täuschen und zu betrügen. Sie tun nur das, was sie sagen.”

Dass es den © grünen Gaunern (geschützter Pleonasmus) mitnichten um das Klima geht, sondern um Geld für ihre subventionierte Windrad-Klientel auf der einen, die Zerstörung Deutschlands als Industrienation bzw. überhaupt Nation auf der anderen Seite, setze ich allmählich als bekannt voraus.

***
Die offenkundige Unausrottbarkeit der „sozialistischen Idee” gründet in der Begehrlichkeit der Nichtsnutze sowie der Illusionsbedürftigkeit und Vergesslichkeit der anderen Menschen. Kaum war der deutsche Realsozialismus eine Generation lang in jenem Orkus verschwunden, wo er hingehört, wollen Ahnungslose wieder von vorne anfangen. Das Phänomen, wie eine Wohnung überhaupt entsteht, ist Figuren, die Wirtschaft für ein Ausbeutungsverhältnis halten, ein Buch mit sieben Siegeln. Wenn es irgendwo genug Wohnraum gibt, dann aus einem einzigen Grund: Weil er nicht verteilt wird. Alles, was staatlich verteilt wird, endet im Mangel.

Schade, dass man Dummchen wie diese Zeit-Maus nicht für ein erkenntnisförderndes Sündenjährchen dorthin verfrachten kann, wo ihnen der Wohnraum tatsächlich zugeteilt wird.
***
Im Acta-Notat vom 8. Februar verwies ich auf einen FAZ-Artikel, den der Autor Sören Sieg in eigener Sache verfasst hatte (etwas scrollen). Er beschrieb darin, wie sein Buch „Oh, wie schön ist Afrika …” die postkoloniale Lektoratszensur, „Sensitivity Reading“ genannt, überstanden habe. Die „rassismuskritische” Lektorin hatte zuvor in seinem Manuskript gestrichen und umformuliert, wie es kein königlicher Zensor jemals gewagt hätte. Die Veröffentlichung in der FAZ mag dazu geführt haben, dass der Verlag das Buch schließlich nur mit marginalen Änderungen druckte, meine ausführliche Erwähnung wiederum dazu, dass es mit einer freundlichen Widmung bei mir eintrudelte. Inzwischen habe ich es gelesen, wobei ich mich bemühte, die Zeilen mit den Maulwurfsaugen einer blütenweißen Sensitivity Zensor:in zu pflügen, die aus dem Manuskript nicht nur fast alle Beschreibungen individueller Eigenheiten, sondern sogar die Worte „Afrika“, „Afrikaner“, „afrikanisch“ und auch die wiederholten Beteuerungen von Einheimischen: „That’s Africa!“ tilgen will, weil sie „Afrika“ für eine Konstruktion der Weißen hält.
Worum geht es? Sören Sieg, Sänger, Komponist, Musikant und Autor, schildert im Buch seine Reiseerlebnisse in sechs afrikanischen Ländern (Äthiopien, Uganda, Kenia, Tansania, Südafrika und Ghana). Die Art und Weise seiner Touristik nennt sich „Couchsurfing”, das ist so etwas wie Airbnb für Anspruchslose oder eben Abenteuerlustige. Die Sache beruht auf einem mit Airbnb-Reservierungssystem vergleichbaren wechselseitigen Bewertungssystem von Gast und Gastgeber, kostet Ersteren aber nichts außer kleinen Geschenken, eventuellen Einladungen und Honoraren für Guide-Dienste, weshalb der Begriff „anspruchslos” ein Euphemismus ist – jede zweite im Buch beschriebene Bleibe ist unzumutbar (und zuweilen ergreift der Autor auch nach der ersten Nacht die Flucht). Der Sinn des Couchsurfings besteht darin, dass sich zwischen Host und Besucher ein persönlicher Kontakt herstellt und der Reisende mehr über Land und Leute erfährt, als wenn er sich im Hotel oder eben via Airbnb einmietete. Die von Sieg geschilderten Erlebnisse und Zustände kommen also dem, was man prosaisch die Realität nennt, recht nahe, wobei dem Autor natürlich jederzeit die Möglichkeit offen steht, in die Komfortzone zu wechseln oder ganz abzureisen; er bleibt ein Hospitant und betont das auch immer wieder.
Das Buch handelt also nicht von Safari, Serengeti und Afrika-Romantik, es geht auch nicht (oder nur am Rande) um die sogenannte Entwicklungshilfe und die angebliche Verantwortung des Westens für den schwarzen Kontinent, wie sie rote und grüne Lautsprecher penetrant betonen und von der zuletzt auch die Heimsuchung im Hosenanzug in ihrer gesammelten Ahungslosigkeit („Jahrhunderte”!) kündete:

Stattdessen handelt das Buch vor allem von den Gastgebern, ihren Lebensgeschichten, Lebensumständen und Ansichten. Die gern behauptete Verantwortung der Weißen für die von offenbar unmündigen Schwarzen bewohnten Länder, deren politische Selbstständigkeit inzwischen fast so lange währt wie zuvor der Kolonialismus, konterkariert der Autor mit der schnöden Wirklichkeit: „Woanders zweigen Politiker vielleicht fünf Prozent Provision für sich ab, hier sind es gern mal 90 Prozent”, erzählt einer seiner Beherberger. „Was glaubst du, warum es hier noch keine funktionierenden Straßen gibt nach 50 Jahren Entwicklungshilfe?” Die Idee der Entwicklung, von welcher der Westen so besessen sei, scheitere vor allem am Fatalismus der Einheimischen. Sieg erläutert das am Beispiel der überall entweder fehlenden oder alten und zerlöcherten Moskitonetze. Statt genügend davon herzustellen, erkläre man achselzuckend, dass Afrika eben der Kontinent der Moskitos sei und nehme die Malaria-Erkrankung als normalen Bestandteil seiner Biographie in Kauf. „That’s Africa!” Stromausfall? „That’s Africa!” Kein Wasser? „That’s Africa!” Schlechte Straßen? „That’s Africa!”
Der afrikanophile Globetrotter zitiert einen amerikanischen Bekannten, der eine in Tansania und Kenia tätige NGO gegründet hat, die dort das Handwerk und die lokale Kultur fördert sowie zwei Schulen betreibt; der Mann hielt in einem der wohl nicht gerade seltenen Momente des Zweifels am Sinn seiner Unternehmungen einem Einheimischen vor: „Weißt du, was ich für euch aufgegeben habe? Worauf ich für euch verzichtet habe? Ist euch das klar? Nur, um euch zu helfen?“ Der Schwarze habe ihn nur zweifelnd angeschaut und erwidert: „Du bist ja noch viel dümmer, als ich gedacht hatte.“
Afrika sei der uns fremdeste Kontinent, schreibt der von dieser Fremdheit so faszinierte Autor. Die fünf großen Weltzivilisationen – Europa, Arabien, Persien, Indien, China – hätten sich seit Jahrtausenden ausgetauscht und gegenseitig befruchtet. „Nur eine Ecke der Welt war davon komplett abgeschnitten: das Afrika südlich der Sahara. Keine Schrift, keine Malerei, keine Architektur, keine Epen, keine heiligen Schriften, keine Philosophen, keine Technologie.” Andererseits, zitiert er einen in Daressalam lebenden Inder namens Sandeep, „wieso reden wir immer von Armut? Wie definieren wir überhaupt Armut? Weil jemand in einer Hütte auf dem Dorf lebt, ohne Strom und fließendes Wasser, ist er arm? Wenn er aber doch umgeben ist von seiner Frau, seinen Kindern, seinen Ziegen und Kühen, seinem Tribe, seiner Gemeinde – wieso nennen wir ihn arm? Er ist nicht arm. Wir definieren nur, dass er arm ist.”
Das mag nett klingen, aber dass Afrika arm ist, definieren nicht „wir”, sondern die Millionen, die über das Mare nostrum nach Europa drängen bzw. dafür bereitstehen. Afrika, das heißt – und Sieg beschreibt es ausführlich – Korruption, endlose Slums, Wellblechhütten, Tribalismus (die innerafrikanische Form des Rassismus), Voodoo, Dreck, Müll, Insekten, katastrophale Sanitäranlagen, Autos, die schon vor 30 Jahren durch den TÜV gefallen wären, Kriminalität, sexuelle Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Staatsgewalt, überhaupt Gewalt, Homosexuellenfeindlichkeit, Väter, die ihre Familien verlassen und den Frauen keinen Cent zahlen, Hitze, Staub, Bettelei, Unverbindlichkeit, habituelles Lügen, und kaum etwas funktioniert. Aber zugleich Lebensfreude, Optimismus, lachende Menschen, Scharen von Kindern, Frauen in langen, farbenprächtigen Kleidern, kleine, meist hinter Mauern und Stacheldraht verborgene Oasen von Reichtum und architektonischer Schönheit, Musik, Tanz, Sex, Freiheit, grandiose Landschaften und eine alle westlichen Vorstellungen übertreffende Fülle der Vegetation. Und Zeit! Mitunter hat es den Eindruck, als besäße Afrika mehr Zeit als der Westen Geld (die Kehrseite ist, dass es keine verbindlichen Termine gibt). Außerdem Gottesdienste mit Gesängen, die dem Touristen die Tränen in die Augen treiben.
„Musik, Tanz und Theater entstehen und vergehen im Augenblick. Unser Streben nach Vollkommenheit dehnt sich in der Zeit, hier ist alles im Moment bereits da – um im nächsten Moment zu verschwinden”, sinniert Sieg. „Wir verstehen nicht mal ansatzweise, warum Afrikaner ihre Tradition so wertschätzen. Sie verstehen nicht, warum wir unsere so leichtfertig preisgeben.” An anderer Stelle beschreibt er ein altes Haus mit einem großen Garten, in dem der Vater des Besitzers begraben liegt. Während das Haus zerfällt, ist das Grab gepflegt. Ambivalenz ist das Mindeste, was der Leser bei der Lektüre empfindet.
Gewiss, vieles, was unsereinem als unzumutbar erscheint, mag sich mit einer gewissen Dickfelligkeit und auch Gewöhnung ins Erträgliche fügen. Was heißt schon Kriminalität? „Gefährlich? Nairobi ist doch nicht gefährlich!”, schreibt Siegs Gastgeberin Joy via Chat vor der Anreise. „Ich bin erst zweimal überfallen worden.” Was bedeutet schon Staatsgewalt? „Kriminelle umzubringen werde in der Polizei als gute Sache angesehen. Also bringe man sie einfach um”, notiert der Autor. Mit einer speziellen Klientel von Betrügern, den „Zauberern”, legten sich die Polizisten übrigens nicht an – aus Angst davor, von ihnen verhext zu werden.
Während in Europa eine entsetzliche Kinderarmut und eine „Kultur des Todes” (Benedikt XVI.) herrschen – in England wurde gerade eine Frau verhaftet, weil sie vor einer Abtreibungskrinik still gebetet hatte – und die Bevölkerungspyramiden abendlandweit auf dem Kopf stehen, vermehrt sich die Bevölkerung auf dem schwarzen Kontinent so ungehemmt wie durchaus unverantwortlich. „Tinna hat 19 Geschwister, ihr Vater hatte mit ihrer Mutter zwölf Kinder, mit seiner Zweitfrau acht”, registriert Sieg, „Tembo, dieser kräftige, unverwüstlich aussehende Hühne mit der überschäumenden Energie, ist eines von 24 Kindern, und zwar Nummer 21. Sein Vater habe ihn häufig gefragt, wie er heiße und von welcher seiner vier Frauen er eigentlich stamme.”
Nach der Familie bildet der Stamm das nächste Bollwerk der Exklusivität. In Tansania lebten 128 Tribes, erzählt ein Führer, er selbst gehöre zu den Haya, das sei der gebildetste Stamm, der allen anderen überlegen sei. Warum? „Weil die Deutschen bei uns zuerst gesiedelt haben. Die haben Kirchen und Schulen für uns gebaut und uns die Bildung gebracht. Jeder weiß doch, wie gebildet die Deutschen sind.” (Gott bewahre Tansania vor einem Staatsbesuch von Annalena B.!) Sieg muss bei diesen Worten an einen Taxifahrer in Hamburg denken, der erklärt hatte: „Leute, die in Afrika waren, reden immer anders über Afrika als Leute, die noch nie in Afrika waren.” Und er fährt fort: „Wer noch nie in Afrika war, käme nicht im Traum darauf, ein Afrikaner könne die deutschen Kolonisten als Ursache für die Überlegenheit seines Tribes ansehen.”
Apropos Kolonialismus. Der Couchsurfer aus Deutschland beschreibt, wie er ein Livingstone-Haus besucht, „eines von vielen in Afrika”, in Mikindani, einer Küstenstadt am Indischen Ozean (die Rede ist von David Livingstone, dem schottischen Missionar, Afrikaforscher und Entdecker der Viktoriafälle): „Die Bewunderung und der Respekt, die Livingstone, diesem Arzt, Familienmensch, Einzelkämpfer, Missionar, Forscher, heute noch in Afrika entgegenschlagen (immer ist die Rede von ‚Doctor Livingstone’), beeindrucken mich zutiefst. Livingstone kämpfte gegen die Sklaverei zu einer Zeit, als sie den afrikanischen Chiefs, die sie betrieben, als völlig normal erschien, und erst recht den Arabern, deren Haupteinnahmequelle sie war. Pragmatisch versuchte er, neue Handelswege und Güter zu erschließen, um den Handel mit Sklaven überflüssig zu machen.”
Mikindani war eine der Provinzhauptstädte von Deutsch-Ostafrika. 1895 erbauten die Deutschen dort ein Verwaltungszentrum, in dem sich heute ein verhältnismäßig luxuriöses Hotel befindet, das „Old Boma”. Interessant ist die Benennung der Zimmer: Eine Suite heißt nach Julius Nyerere, dem ersten Präsidenten Tansanias, ein Sozialist übrigens; ein Zimmer trägt den Namen des deutschen Generals Paul von Lettow-Vorbeck. „Dem deutschen Gouverneur, unter dem das Boma gebaut wurde, ist eine Suite gewidmet, aber auch Chief Mkwawa, der den Aufstand gegen die Deutschen in derselben Zeit anführte.” Wie einfach. Wie vernünftig. Die Menschen dort scheinen uns entweder weit voraus – oder doch noch nicht so weit – zu sein.
Siegs Reiseeindrücke bestätigen das Vorurteil, dass Weiße bei Schwarzafrikanern beliebter sind als beispielsweise unter ihren Rassengenossen – hui! – in westlichen Universitäten, Redaktionen und progressiven Parteien. Die antirassistischen und postkolonialistischen Konzepte scheinen sich dort nicht so recht verbreiten zu wollen, womöglich mangels engagierter Missionare – welches woke Bleichgesicht will sich schon von Moskitos und Wanzen zerstechen lassen, auf alten Matratzen nächtigen und Klos ohne Spülung benutzen? Ein gewisser kapitalistischer Wohlstand ist die Grundvoraussetzung für die Entstehung des woken Weltgefühls. Auch in Afrika übrigens. In Masaki, dem Expatstadtteil von Daressalam, stößt Sieg auf eine Buchhandlung. „Die Verkäuferin ist eine ältere weiße Engländerin, es läuft BBC, vorn stehen Bücher gegen Rassismus, Kolonialismus und Kapitalismus”, notiert er. „Die Bücher reflektieren weiße westliche Einstellungen, sie kritisieren das ‚weiße Privileg’, sind meiner Meinung nach aber auch nur für Privilegierte interessant. Dieses sich als ‚kritisch’ verstehende Denken, wo lebt es, wo siedelt es sich an? Im privilegiertesten Teil von Daressalam, in einem Lebensraum für Weiße, der Waterfront, schneeweiße arabische Architektur am Meer, Palmen, breite, gepflegte Wege, Restaurants mit europäischen Preisen. Wann hat hier zuletzt ein Einheimischer, ein ganz normaler Tansanier, ein Buch gekauft?”
Der Leser ahnt, es muss noch einiges an feministischer Außenpolitik geleistet werden, wobei sich dieses Geschäft immerhin als Brückenkopf anbietet: „Die Kinderbücher stehen ganz hinten im dunklen Teil des Ladens. Die Verkäuferin kann mir keines empfehlen, sie hat keine Kinder.” Das ist von tiefer Symbolik: In einem Land, wo die durchschnittliche Einheimische fünf Kinder hat, kämpft eine kinderlose Weiße gegen Rassismus.
Man nennt Weiße übrigens in Ostafrika „Muzungu” (Mzungu); das ist ein Wort aus den Bantusprachen und bedeutet ungefähr „zielloser Wanderer”. Der Muzungu ist ein Exot, den man herumreicht, umschwärmt, ausfragt, anfassen will, anbettelt, abzockt – es gibt den Verkaufspreis für Einheimische und den für Muzungus –, und im ungünstigen Fall lockt man ihn in eine Falle, um ihn zu berauben. Sieg nennt es die „Muzungu-Cashcow-Existenz”.
Einmal, in Uganda, wird er aufgefordert, bei einem Gottesdienst zu reden. Die Kirche ist eine umdekorierte Wellblechhütte. Zum ersten Mal in der Geschichte der Gemeinde habe Gott einen Muzungu zu ihnen gesandt, sagt der Prediger. „Weißer Mann, sprich zu uns!” – eine heikle Sache für einen Atheisten. Nachdem sich der Gast mehr schlecht als recht der Aufgabe entledigt hat, folgt der lustige Teil seines Auftritts. Der Vorbeter erklärt: „Übrigens hat der Munzugu eine verrückte Eigenheit. Er isst kein Fleisch! Stellt euch das vor, kein Fleisch und keinen Fisch! Weißer Mann, erkläre uns, warum isst du kein Fleisch?” Sieg: „Ich schaue etwas verlegen in die Menge. ‚Nun, ich möchte eben nicht, dass meinetwegen Tiere getötet werden.’ Die Gemeinde bricht in ein schallendes, ausgelassenes Gelächter aus.”
Kehren wir zurück zur sensitiven Korrekturleserin im Goldmann-Verlag, der übrigens zum Bertelsmann-Konzern und zur Penguin Random House-Verlagsgruppe gehört, und versetzen wir uns in ihr Dilemma. Vor ihr liegt ein Buch, das sich realer afrikanischer Akteure bedient, um die afrikanische Realität so zu beschreiben, wie sie ist – statt wie sie sein sollte –, und das weder Afrikakitsch noch Verantwortungsschwulst verbreitet, noch Weißenkritik übt, noch die Kolonialschuld anklagt. Die Maid erkennt sofort die Gefahr und schreibt an den Autor: „Sie reproduzieren kolonial-rassistische Machtstrukturen!” Perfiderweise ist es aber gar nicht der Autor, der das tut, sondern es sind die Einheimischen, die er trifft und zitiert und die ständig unverzeihliche Sachen sagen, was, wenn man es schon nicht mehr rückgängig machen kann, sich zumindest nicht wiederholen darf. Was wissen denn irgendwelche noch nicht zur Wokeness bekehrten Bimbos von Afrika? Das wäre ja so, als überließe man den Ossis die Beurteilung des Sozialismus!
Gleichwohl soll eine Afrikanerin das Schlusswort sprechen, eine von Siegs Gastgeberinnen, eine Polizistin übrigens:
„ ‚Ich war letzten Sommer in Finnland. Dort gibt es schon so viele Somalis. Und die kriegen alle acht, neun Kinder. Die Finnen bekommen nur ein oder zwei Kinder. Langfristig wird das zu riesigen Problemen führen.’ Und mit den Muslimen sei ihrer Erfahrung nach nicht gut Kirschen essen. Sie sei schon öfter zu Untersuchungen in den muslimischen Nordosten gefahren. Da könne sie nicht einfach mit den Frauen oder Mädchen reden, die Opfer von Vergewaltigung oder Missbrauch geworden seien. Sie müsse erst auf Knien den Ehemann oder Vater um Erlaubnis bitten. Die meisten sagten, wir wollen keine Polizei, wir regeln das unter uns, wir bekommen ein Kamel von der Familie des Täters, oder er heiratet sie, und damit ist gut. ‚Ihr müsst die Einwanderung regulieren und beschränken’, warnt sie. ‚Oder ihr werdet langfristig euer Land verlieren. Wir in Afrika legen sehr viel Wert darauf, die eigene Kultur zu behalten. Da könnt ihr einiges von uns lernen.’ ”
(Sören Sieg, „Oh, wie schön ist Afrika…”, München 2022, 318 S., 16 Euro)
***
Leser ***